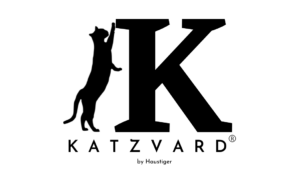Impfen kritisch sehen. Ja! Aber bitte mit Hirn.
Vorsorge
Impfen kritisch sehen. Ja! Aber bitte mit Hirn.
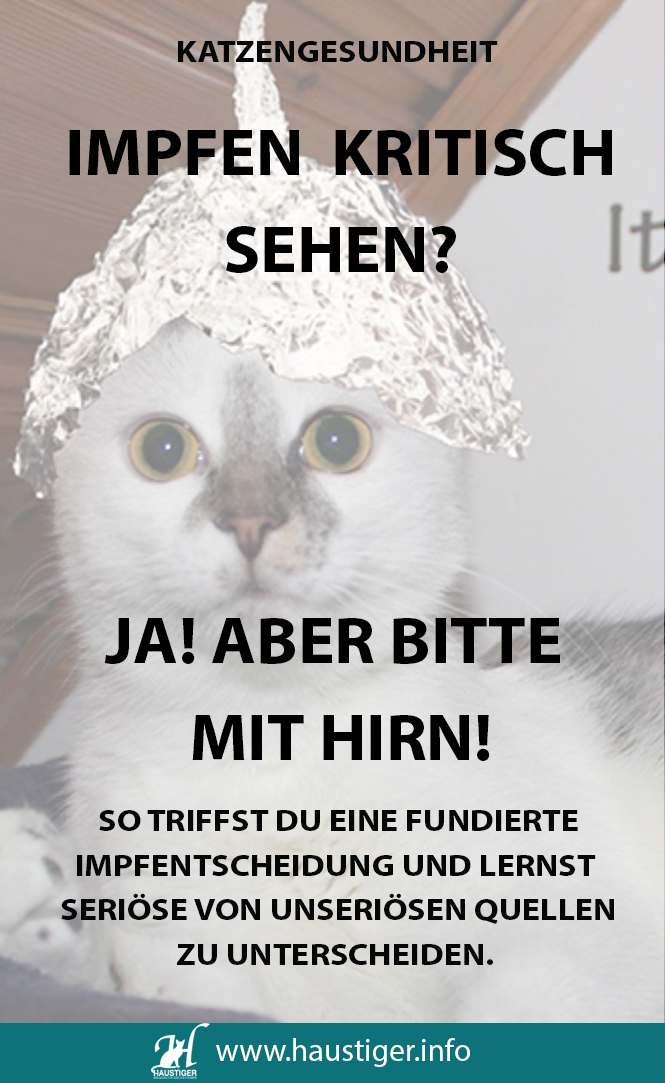
Nun verbreitet sich von eben jener Tierärztin eine Stellungnahme in den sozialen Medien, in der sie mitteilt, dass sie selbst keine Tiere mehr impfen wird und wieso und weshalb. Wasser auf die Mühlen der Impfgegner, die in Krankheiten wie Katzenseuche und Co. nur eine Erfindung von Big Pharma sehen und der festen Überzeugung sind, dass die Pharmaindustrie ebenso wie DIE Tierärzte (ich liebe ja Pauschalisierungen) mit Impfungen nur Geld scheffeln wollen.
Impfen ist kein einfaches Thema. Es ist ein Thema, das zu vielen Grundsatzdebatten führt, weil vieles immer noch so gemacht wird, wie es schon immer gemacht wurde, weil viel Angst und Unsicherheit im Spiel ist, auch viele falsche Informationen und weil es einfach keinen pauschalen Impfplan gibt, der für jede Katze greift. 100 Leute, 200 Meinungen. Front gegen Front. Und noch viel mehr Unsicherheit, wenn auch noch ausgerechnet eine Tierärztin sagt, dass Impfen für die Tonne ist und Katzen krankmacht. Jedoch sollte man gerade von einer Tierärztin erwarten können, dass sie Entscheidungen auf Basis seriöser Quellen trifft und auch mit ebensolchen argumentiert.
Das ist leider nicht der Fall. Da wird zum Beispiel eine Studie angeführt, die bewiesen haben will, dass ungeimpfte Kinder gesünder als geimpfte seien. Klickt man auf den zugehörigen Link, trifft man nicht etwa auf die Studie selbst, sondern auf eine Auswertung eben jener Studie einer Elterninitiative für Impfaufklärung, die behauptet, dass jetzt amtlich bewiesen sei, dass Impfen der Gesundheit schade. Erkenntnisse, die dann u. a. vom Kopp-Verlag aufgegriffen wurden. Ihr wisst nicht, wer das ist? Wikipedia hilft.
Sieht man sich die Studie selbst an, sieht man, dass es keine wesentlichen Unterschiede in der Anzahl durchgemachter Infekte (wie Erkältungen, Bronchitis, Magen-Darm-Erkrankungen) gab, ebenso wenig hinsichtlich Allergien, aber der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die schon einmal an Keuchhusten, Masern, Mumps und/oder Röteln litten, bei den ungeimpften Personen deutlich höher war.1 Klar, hat das Immunsystem mit einer Impfung erst einmal zu tun. Klar, kann man sich dadurch nach einer Impfung einen Infekt einfangen, weshalb man bei roh gefütterten Katzen in der Zeit kurz nach der Impfung zum Beispiel auf riskantere Fleischsorten verzichten kann. Aber ganz ehrlich, lieber vorübergehender Infekt als bleibende Schäden oder Tod.
Weiter geht es mit der Aussage, dass nur durch neurotoxische Adjuvantien, wie Aluminium und Quecksilber in den Impfstoffen, Antikörper gebildet würden. Es sei ohne Adjuvantien nicht möglich, eine Antikörperbildung zu provozieren und man überlege, wogegen die Antikörper denn nun wirklich gerichtet seien.
Nun. Es gibt verschiedene Arten von Impfstoffen. Wir haben da drei große Gruppen,
– die Lebendimpfstoffe, die lebende aber abgeschwächte Erreger enthalten,
– die Totimpfstoffe, die abgetötete oder inaktivierte Erreger enthalten
– und rekombinante Impfstoffe, die Proteine oder Bruchstücke von Nukleinstoffen enthalten.
Adjuvantien, wie eben Aluminiumhydroxid oder die Quecksilberverbindung Thiomersal, findet man in den Totimpfstoffen, wo sie zur Verstärkung der Immunantwort eingesetzt werden und nicht dazu, dass überhaupt Antikörper gebildet werden. Und zwar nur in denen. Jetzt gibt es aber ja wie eben erwähnt auch noch Lebendimpfstoffe und rekombinante Impfstoffe, durch die man bei den gängigen Impfungen (Katzenschnupfen, Katzenseuche, Tollwut, FeLV) wunderbar auf Totimpfstoffe verzichten kann. Und natürlich werden auch bei Lebend- und rekombinanten Impfstoffen Antikörper gebildet, ganz ohne Adjuvantien.
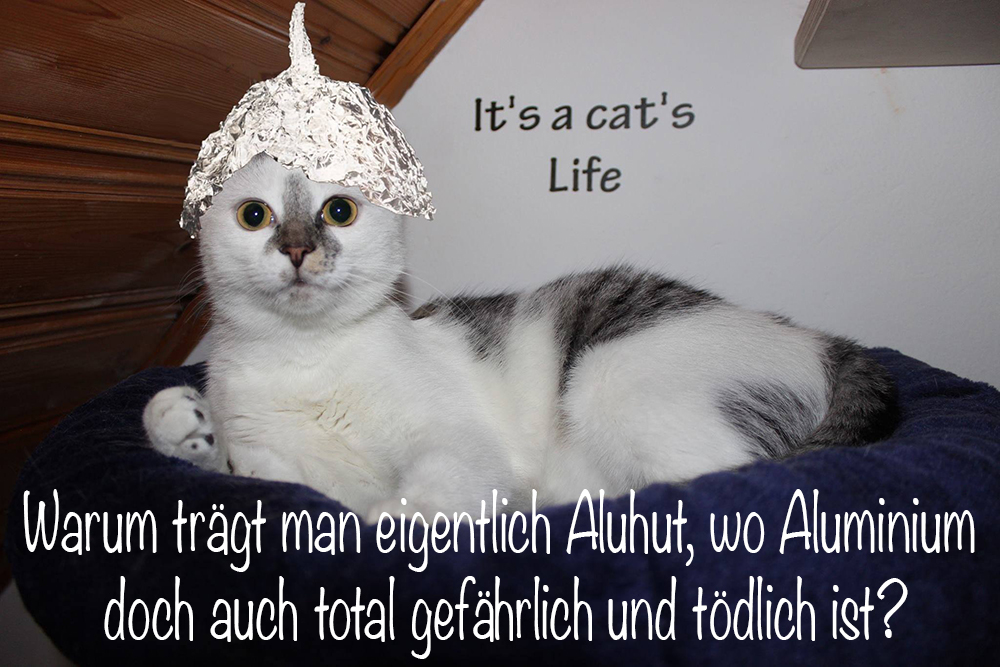
Was gibt es noch? Ach ja, Buch- und Website-Empfehlungen. Da ist dann wirklich alles dabei, was das Impfgegnerherz begehrt. Bücher, die behaupten AIDS, BSE, Kinderlähmung oder auch gerne Viren generell seien nur eine Erfindung der Medizinindustrie, Bücher, die zum Aufbruch aus dem bakteriozentrischen Weltbild aufrufen, die Enthüllung der EHEC-, Tetanus- und Masernlüge und so weiter und so fort. Eben jene Leute tummeln sich dann auch auf dem Stuttgarter Impfsymposium, dessen Besuch empfohlen wird, um sich eine eigene Meinung zu bilden.

Emma (Schlaumiez)
Den Abschluss bildet die Beschreibung von positiven Erfahrungen. So hätten ungeimpfte Tiere nach eigener Beobachtung weniger chronische Erkrankungen, Allergien und hartnäckige Infekte und die Tiere wären an sich lebhafter, gesünder und widerstandsfähiger. Unklar bleibt, um wie viele Tiere es sich dabei handelt, über welchen Zeitraum gesprochen wird (im ersten Buch 2011 werden Impfungen mit Sinn und Verstand noch empfohlen) und ob nicht vielleicht doch eher andere Umstände für die Verbesserung gesorgt haben, zum Beispiel die Umstellung auf eine artgerechtere Ernährung, die ja oft erfolgt, wenn man sich kritisch mit dem Thema Katzengesundheit zu beschäftigen beginnt…
Unser Appell an euch
Impfen ist ein Thema, bei dem man kritisch sein darf, ja sogar kritisch sein muss, was die Auswahl der Impfungen, der Impfstoffe und der Intervalle und der Impfstelle angeht. Wahllos alles impfen zu lassen, was geht und am besten auch noch jährlich ist ebenso falsch, wie Impfungen generell zu verteufeln.
Bitte benutzt euren gesunden Menschenverstand. Wer im Tierschutz schon einmal Katzenseuche erleben musste, wer weiß, wie Katzenschnupfenaugen aussehen, wenn Hornhautgeschwüre durchbrechen und sich ungefähr vorstellen kann, welche höllischen Schmerzen das sein müssen, wer gesehen hat, wie Schnupfenkitten aussehen, denen man gerne geholfen hätte, bei denen es aber schon zu spät war … dem geht bei solchen Aussagen, wie den oben getätigten, buchstäblich das Messer in der Tasche auf, glaubt mir. Vieles ist heute nicht mehr so richtig greifbar, weil man gottseidank als Katzenhalter nur selten damit zu tun hat (Katzenseuche z. B.). Aber dennoch ist es da.
Es ist richtig, dass keine Impfung zu 100 % schützt, dass es Impfdurchbrüche geben kann (selten), Nebenwirkungen (auch selten) und die Impfung auch zum Beispiel beim Katzenschnupfen nicht gegen alle Stämme wirksam ist und „nur“ die Symptome lindert. Es ist auch richtig, dass es z. B. bei FeLV höchstwahrscheinlich eine Altersresistenz gibt und es daher vor allem wichtig ist, junge Freigänger zu schützen. Man muss auch nicht jährlich gegen alles impfen, aber wie besagte Tierärztin in ihrem ersten Buch auch noch sehr richtig schreibt:
Der beste Schutz für Hunde und Katzen vor schlimmen Krankheiten ist erst einmal eine stabile Immunität. Diese wird vor allem durch sinnvolle Grundimmunisierungen, durch verbesserte Haltungsbedingungen und artgerechte Fütterung erreicht.
Eine ordentliche Grundimmunisierung beginnt mit den Impfungen im Kittenalter und endet mit der Impfung mit 15 Lebensmonaten! Nicht früher. Über die Impfintervalle bei den Wiederholungsimpfungen bzw. ob man welche machen lässt und ob man neben den Core-Impfungen noch andere Impfungen geben lässt, kann man diskutieren, aber die Grundimmunisierung muss im Interesse eurer eigenen und auch der Katzen anderer ordentlich gemacht werden!
Prüft genau, wem ihr Glauben schenkt. Wollt ihr wirklich dubiosen Quellen, wie den oben genannten unreflektiert vertrauen?
Informiert euch, seid kritisch und denkt auch an die Katzen, die
– noch nicht geimpft werden können,
– generell nicht geimpft werden können,
– nicht mehr geimpft werden können.
Auch diese schützt ihr, darunter auch speziell Katzenkinder, die den genannten Krankheiten nur wenig entgegenzusetzen haben (Herdenschutz). Andersherum schützen die Katzenhalter, die ihre Katzen impfen lassen, auch wieder eure Katzen mit. Manch böse Zunge in Tigerfell würde das jetzt Schmarotzer nennen. Wir sind zu nett für so böse Worte, aber bisschen unfair darf man das schon finden, oder?
Bleibt kritisch, recherchiert selbst und um es mit dem Leitspruch der Aufklärung von Immanuel Kant zu sagen: Habt Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen! Nicht mehr, aber auch nicht weniger wünschen wir uns von euch.
Newsletter abonnieren
Du möchtest noch mehr Katzenwissen? Dann abonniere doch unseren Newsletter und erhalte aktuelle Informationen aus der Welt der Katze, praktische Hinweise, Neuigkeiten aus der Forschung, nützliche Links und mehr kostenlos frei Haus.
- https://www.aerzteblatt.de/archiv/80866/Impfstatus-und-Gesundheit-von-Kindern-und-Jugendlichen [↩]