Giardien bei Katzen
„Meine Katze hat da wieder diese Geranien? Oder waren es Gardinen?“ – manchmal tut man sich als Katzenpersonal mit der Bezeichnung für die Plagegeister schwer. Gemeint sind natürlich Giardien.
Aber auch wenn die Namensfindung hin und wieder in der Tierarztpraxis für ein Schmunzeln sorgt, die Stimmung ist bei Befund oft alles andere als heiter: In sozialen Netzwerken liest man von wochenlangen Putzmarathons, Rückfällen nach jeder Behandlung und sogar Gefahren für den Menschen. Schnell entsteht das Gefühl, dass Giardien eine absolute Katastrophe und ein nahezu unlösbares Problem seien.
Ganz so dramatisch wie dargestellt ist es aber meist nicht und Panikmache ist bei Giardien auch nicht angebracht. Die Einzeller kommen bei Katzen ähnlich wie Würmer recht häufig vor, sind aber in den meisten Fällen gut behandelbar.
In diesem Artikel erfährst du, was Giardien eigentlich sind, wie Giardien bei Katzen übertragen werden, welche Symptome typisch sind, wie die Diagnose gestellt wird und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Zudem gehen wir auf unterstützende Maßnahmen und auf das Thema „richtige Ernährung bei Giardienbefall bei der Katze“ ein. Insbesondere auch auf das häufig diskutierte Thema kohlenhydratfreie Ernährung bei Giardienbefall.
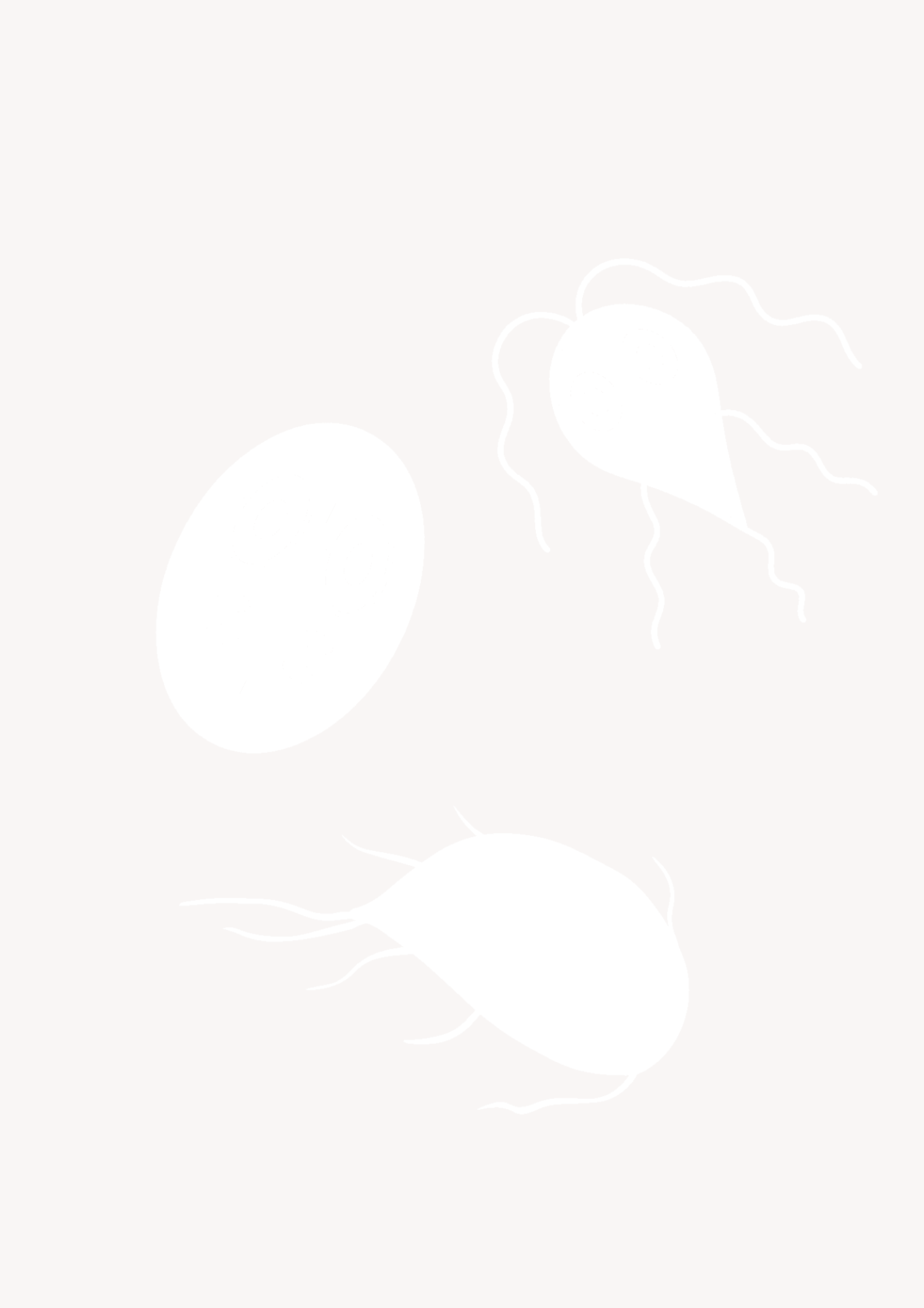
Im Detail

Was sind Giardien?
Giardien sind mikroskopisch kleine, einzellige Parasiten. Genau gesagt, gehören sie zur Familie der Hexamitidae in der Ordnung Diplomonadia. Es gibt verschiedene Spezies, bei der Katze interessiert uns G. duodenalis (wird auch als G. lamblia oder G. intestinalis bezeichnet).
Von G. duodenalis existieren acht Genotypen (Assemblages) A–H, die jeweils bevorzugte Wirte haben. Genotyp F ist z. B. typisch für die Katze. Genotyp A und B haben ein breites Wirtsspektrum, zu dem auch der Mensch zählt. Die Assemblage A kann dann noch einmal in die drei Untergruppen AI, AII und AIII eingeteilt werden, wobei AI bevorzugt beim Tier vorkommt und beim Mensch eher AII.
Da der Genotyp A auch bei Katzen vorkommt, besteht ein zoonotisches Potenzial (Übertragung zwischen Katze und Mensch). Die Übertragung vom Tier auf den Menschen ist, sofern sie überhaupt vorkommt, selten.
Die einzelnen Genotypen sind aber nicht wirtsspezifisch und es können bei einem Tier auch verschiedene vorliegen. Andere Assemblages infizieren z. B. bevorzugt Hunde (C, D), Rinder (E), Ratten (G) oder Meeressäuger (H).
Um herauszufinden, welche Genotypen vorliegen, braucht es eine PCR.
Lebenszyklus der Giardien
Giardien kommen in zwei Formen vor: Trophozoiten und Zysten. Die Trophozoiten sind die vermehrungsfähige Form, die Zysten die infektiöse, umweltresistente Form, über die Giardien von einem Tier auf andere oder den Menschen übergehen können.
Zyklus:
1) Giardien-Zysten werden z. B. über durch Kot verunreinigte Nahrungsmittel oder Wasser aufgenommen.
2) Im Dünndarm exzystieren die Zysten (d. h. sie öffnen sich) und es entwickeln sich Trophozoiten. Damit sich die Giardien-Zysten öffnen können, braucht es vorbereitend das saure Milieu der Magensäure.
3) Die Trophozoiten vermehren sich asexuell in mehreren Zyklen und zystieren anschließend, bilden also wieder Zysten.
4) Zysten und Trophozoiten werden von der Katze über den Kot ausgeschieden. Allerdings können nur die Zysten außerhalb des Wirts überleben und andere Katzen mit Giardien anstecken.
5) Die Zysten sind sofort infektiös und können monatelang überleben. Um ein anderes Tier oder den Menschen mit Giardien zu infizieren, sind nur wenige Zysten notwendig.

Ansteckung und Vorkommen
Giardien werden fäkal-oral übertragen, also wie bereits erwähnt z. B. über Wasser oder Nahrungsmittel, die mit Kot kontaminiert sind. Da die Zysten lange in der Umwelt überdauern können, ist auch eine indirekte Übertragung möglich.
Die genauen Zahlen schwanken je nach Population und Untersuchungsmethode. Grundsätzlich ist die Infektionsrate bei Katzen niedriger als bei Hunden und kann z. B. bei Streunern, in Tierheimen oder in Zuchthaushalten deutlich höher liegen, als im „normalen“ Katzenhaushalt. Als Richtwert kann man in Deutschland davon ausgehen, dass rund 12 Prozent der Katzen von Giardien betroffen sind.
Besonders bei Jungtieren sind die einzelligen Parasiten ein Thema. Hier kann die Prävalenz bei Katzen unter 6 Monaten auf 50 % ansteigen. Zudem scheint es einen Zusammenhang zwischen einer Giardieninfektion und dem männlichen Geschlecht, dem gleichzeitigen Vorkommen von Kryptosporidien und anderen parasitären Co-Infektionen sowie fehlender Entwurmung zu geben.
Nach einer Ansteckung mit Giardien dauert es etwa 10 Tage bis zwei Wochen, bis erste Zysten ausgeschieden werden. 1Belosevic M, Faubert GM, Guy R, MacLean JD (1984): Observations on natural and experimental infections with Giardia isolated from cats. Can J Comp Med 48(3), 241-244. Während der akuten Infektionsphase kann die Ausscheidung entweder durchgehend oder in Schüben erfolgen.
In den meisten Fällen gelingt es Katzen, die Parasiten innerhalb von vier bis sechs Wochen von selbst wieder loszuwerden. Bei experimenteller Infektion mit einer sehr hohen Anzahl an Zysten kann die Infektion in manchen Fällen bis zu 28 Wochen nach der Ansteckung anhalten 2 Stein JE, Radecki SV, Lappin MR (2003): Efficacy of Giardia vaccination in the treatment of giardiasis in cats. J Am Vet Med Assoc 222(11), 1548-1551.
Was machen die Giardien im Darm der Katze?
Giardien heften sich an den Bürstensaum der Darmzellen (Enterozyten) im Dünndarm und führen insbesondere im Zwölffingerdarm (Duodenum) und Leerdarm (Jejunum) zu strukturellen und funktionellen Veränderungen der Darmschleimhaut. Dabei entstehen mechanische Schäden, die Mikrovilli (winzige Fortsätze der Darmzellen zur Oberflächenvergrößerung) können sich verkürzen und die Oberfläche der Schleimhaut, über die Nährstoffe aufgenommen werden, wird kleiner. Zusätzlich sind die Parasiten in der Lage, den programmierten Zelltod (Apoptose) von Darmepithelzellen auslösen und die intestinale Barriere zu schädigen. In Folge sind sowohl die Verdauung (Maldigestion) als auch die Aufnahme (Malabsorption) von Nährstoffen gestört.
Da die durch die Malabsorption nicht aufgenommenen Substanzen osmotisch aktiv sind und Wasser in den Darm „saugen“, kann es zu osmotischem Durchfall kommen. Eine vermehrte Abgabe von Chloridionen in den Darm, die dazu führt, dass Wasser in den Darm nachströmt, trägt ebenfalls zur Durchfallentstehung bei (sekretorischer Durchfall). Entzündliche Reaktionen sind meist nur gering ausgeprägt, können die Schleimhaut aber zusätzlich beeinträchtigen.
Bei starkem Parasitenbefall bedecken Giardien große Abschnitte der Darmschleimhaut, was insbesondere bei Jungtieren oder immungeschwächten Katzen zu deutlichen Funktionsstörungen führen kann. Die geschädigte Schleimhaut begünstigt zudem bakterielle Sekundärinfektionen.
Giardien bei Katzen: Symptome
Ob bei Katzen mit Giardienbefall sichtbare Krankheitsanzeichen auftreten, hängt von verschiedenen Faktoren wie Alter, Immunstatus, allgemeinem Gesundheitszustand und Ernährungszustand ab.
Typische Symptome sind vor allem wiederkehrender oder chronischer Durchfall, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Der Kot betroffener Tiere ist häufig hell und fettig (Steatorrhoe), wässrig-schleimig und stark übelriechend; gelegentlich können Blutbeimengungen auftreten.
Weitere mögliche Symptome sind Gewichtsverlust, Mattigkeit, Erbrechen sowie ein struppiges, glanzloses Fell.
Der Durchfall kann sich über Wochen oder Monate hinziehen, besonders bei wiederholten Reinfektionen oder chronischen Verläufen. Junge Katzen unter einem Jahr zeigen meist die schwersten Krankheitsverläufe und müssen manchmal sogar gepäppelt werden, wenn das Kitten abnimmt oder nicht frisst. Adulte Tiere bleiben häufig symptomlos oder zeigen nur milde Symptome entwickeln. Allerdings scheiden auch asymptomatische Katzen infektiöse Zysten aus und können andere Tiere anstecken.
Auch nach erfolgreicher Behandlung kann es einige Zeit dauern, bis sich die Darmschleimhaut vollständig regeneriert hat, sodass der Durchfall noch fortbestehen kann, obwohl die Parasiten bereits eliminiert wurden.


Diagnose eines Giardienbefalls
Die Diagnose einer Giardieninfektion erfolgt durch den Nachweis von Zysten, Trophozoiten, Antigenen oder Erbgut des Erregers im Kot. Da die Zystenausscheidung oft unregelmäßig verläuft, sollte stets Sammelkot aus zwei bis drei aufeinanderfolgenden oder alternierenden Tagen untersucht werden.
Um Giardien zu diagnostizieren, gibt es verschiedene Verfahren. Der Direktausstrich dient dem Nachweis beweglicher Trophozoiten unter dem Mikroskop. Für den Nachweis von Zysten kommen Flotationsverfahren zum Einsatz. Antigennachweise können zum Beispiel über Verfahren wie ELISA oder Immunfluoreszenztests (IFA) erfolgen.
Die Verfahren sind nicht alle gleich zuverlässig. Welches im individuellen Fall zum Einsatz kommt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel können nicht alle Verfahren direkt in der Tierarztpraxis durchgeführt werden.
Als empfindlichste Methode zum Nachweis von Giardien-DNA gelten derzeit molekularbiologische Verfahren wie die PCR. Über eine PCR kann auch der Genotyp (Assemblage) bestimmt werden. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn man das Risiko für eine Übertragung auf den Menschen einschätzen möchte.
Wichtig: Eine Behandlung ohne gesicherte Diagnose ist nicht zu empfehlen, da sie zum einen das Darmmikrobiom beeinträchtigen kann und zum anderen andere Ursachen für Durchfall übersehen werden könnten.
Behandlung einer Infektion mit Giardien
In bestimmten Situationen – etwa wenn Kleinkinder, ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke oder immungeschwächte Menschen oder Tiere im Haushalt leben oder generell im Mehrkatzenhaushalt – kann es je nach Situation aber sinnvoll sein, auch asymptomatische Katzen gegen Giardien zu behandeln.
Ziel der Therapie ist in jedem Fall die Verbesserung der klinischen Symptome. Da Reinfektionen häufig sind, gelingt die vollständige Eliminierung der Parasiten nicht immer und/oder es sind mehrere Behandlungsdurchgänge notwendig.
Da schon wenige Zysten für eine Ansteckung ausreichen, ist es unerlässlich, dass die medikamentöse Behandlung immer mit Hygienemaßnahmen kombiniert wird, um eine Reinfektion nach Möglichkeit zu vermeiden.
Medikamente zur Behandlung eines Giardienbefalls
Zur Behandlung stehen zwei zugelassene Wirkstoffe zur Verfügung:
Deine Tierärztin oder dein Tierarzt kann dich bei der Frage beraten, ob eine Behandlung erfolgen soll und wenn ja, mit welchem Präparat und nach welchem Behandlungsschema.
Es gibt daneben noch einige andere Substanzen, die gegen Giardien wirken. Allerdings sind diese in Deutschland nicht für diese Indikation zugelassen.
In der Vergangenheit wurde von vielen Katzenhalter*innen zum Beispiel – häufig ohne Rücksprache mit der behandelnden Tierärztin oder dem behandelnden Tierarzt – Carnidazol eingesetzt. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Antibiotikum aus der Gruppe der Nitroimidazole.
Giardienbehandlung hilft nicht?
Die Bekämpfung von Giardien gestaltet sich häufig mühsam, was aber in der Regel nicht an Resistenzen gegenüber den zugelassenen Wirkstoffen liegt (wozu es bisher auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt), sondern an der hohen Reinfektionsrate. Es können mehrere Durchgänge notwendig sein, um Giardien bei der Katze erfolgreich zu bekämpfen.
Zeigt die Katze auch nach (wiederholter) Giardienbehandlung noch Symptome, ist es eine gute Idee, auch andere Ursachen für die gesundheitlichen Probleme in Betracht zu ziehen. Gegebenenfalls sind die Giardien nur eine Begleiterscheinung und nicht das eigentliche Problem.


Hygiene verbessert den Behandlungserfolg
Die Behandlung einer Giardieninfektion ist nicht allein mit Medikamenten erledigt. Ein wesentlicher Grund dafür, dass Infektionen häufig wiederkehren, ist die hohe Reinfektionsrate. Bereits wenige ausgeschiedene Zysten reichen aus, um nach oraler Aufnahme erneut eine Infektion auszulösen.
Daher ist eine konsequente Hygiene und Umgebungsdekontamination während und nach der Therapie entscheidend, um den Behandlungserfolg zu sichern.
Einige wichtige Maßnahmen:
- Kot so oft wie möglich aus den Katzentoiletten entfernen und in geschlossenen Plastikbeuteln über den Hausmüll entsorgen (da dieser verbrannt wird)
- Alle Oberflächen reinigen, die möglicherweise mit Kot in Berührung gekommen sein könnten (z. B. Boden um die Katzentoilette); im Idealfall mit einem Dampfstrahler und einer Mindesttemperatur von 60° Celsius. Oberflächen nach der Reinigung trocknen.
- Flächen soweit möglich mit einem gegen Giardien wirksamen Desinfektionsmittel desinfizieren
- Futter- und Wassernäpfe täglich mit kochendem Wasser reinigen und gründlich abtrocknen
- Katzentoiletten täglich mit kochendem Wasser reinigen und gut abtrocknen
- Decken und Kissen bei mindestens 65° Celsius waschen
- Nicht waschbare, aber möglicherweise kontaminierte Gegenstände (z. B. Kartons) über den Hausmüll entsorgen
- Kratzbäume gründlich reinigen und regelmäßig absaugen
- Hinterteil betroffener Katzen ggf. baden und shampoonieren; langhaarige Tiere können unter Umständen im Analbereich geschoren werden
- Hände nach Umgang mit der Katze gründlich waschen
Hier findet ihr eine Übersicht sinnvoller Hygienemaßnahmen bei Giardienbefall der ESCCAP.
Giardien bei Katzen und Ernährung
Besonders häufig wird dabei empfohlen, auf Kohlenhydrate zu verzichten oder diese zumindest weitgehend zu reduzieren. Klingt auf den ersten Blick auch logisch, da Giardien ihre Energie aus mikroaerophiler Fermentation von Glucose beziehen. Allerdings gibt es bisher keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass der Verzicht auf Kohlenhydrate den Verlauf der Infektion positiv oder negativ beeinflusst. Zudem können Giardien auch ohne erhöhte Zufuhr von Kohlenhydraten überleben, da sie auch in der Lage sind, andere Energiequellen zu nutzen (z. B. bestimmte Aminosäuren).
Kohlenhydrate spielen darüber hinaus auch eine wichtige Rolle für die Gesundheit des Mikrobioms. Denn die nützlichen Darmbakterien sind auf bestimmte Faserstoffe und Stärkeabbauprodukte als Energiequelle angewiesen (Präbiotika).
Das Ausmaß, in dem eine Giardieninfektion das intestinale Mikrobiom beeinflusst, ist bislang nicht abschließend geklärt. Eine Unterstützung des Mikrobioms ist aber dennoch immer eine gute Idee.
Wird der Giardienbefall behandelt – und insbesondere wenn dafür Metronidazol zur Anwendung kommt – ist es sehr zu empfehlen, dass das Mikrobiom auf jeden Fall gezielt mit Biotika (Prä-, Pro- und Postbiotika) unterstützt wird. Gegebenenfalls kann auch eine Kottransplanation (FMT) erwogen werden. Eine solche Unterstützung erfolgt idealerweise bereits während der Behandlung und über mehrere Wochen danach.
Was die Futterumstellung bei Giardienbefall bei der Katze angeht. In den meisten Fällen werden Katzen als obligate Fleischfresser ohnehin schon kohlenhydratarm ernährt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist von einer radikalen Futterumstellung (z. B. auf BARF) bei ohnehin schon geschädigtem Darm aber dennoch eher abzuraten.
Besser ist die Gabe einer leicht verdaulichen Schonkost, die durchaus auch einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten enthalten darf (nicht muss). Hier kommt es darauf an, um welche Art von Kohlenhydraten es sich handelt, in welcher Menge diese enthalten sind und wie gut sie aufgeschlossen und damit verdaulich sind. Per se schlecht sind Kohlenhydrate nicht.
Wenn du trotzdem die Ernährung umstellen willst: Sprich eine geplante Futterumstellung am besten mit deiner Tierärztin oder deinem Tierarzt ab und/oder zieh eine Fachtierärztin oder einen Fachtierarzt für Tierernährung und Diätetik hinzu, um eine professionelle Rationsberechnung durchführen zu lassen, besonders wenn du selbst kochen oder roh füttern (barfen) willst.


Quellen (u. a.)
ABCD – European Advisory Board on Cat Diseases (2025): Guideline for Giardiasis. Verfügbar unter: https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-giardiasis/ (abgerufen am: 10. Oktober 2025).
Adam RD. Giardia duodenalis: Biology and Pathogenesis. Clin Microbiol Rev 2021; 34: e0002419
Barutzki D, Schaper R. Results of parasitological examinations of faecal samples from cats and dogs in Germany between 2003 and 2010. Parasitol Res 2011; 109: S45-S60
Beck W. Giardien – Nr. 1 der Parasiten bei Hund und Katze. team.konkret 2020; 16(04): 16 – 18. doi:10.1055/a-1243-4563
Belosevic M, Faubert GM, Guy R, MacLean JD (1984): Observations on natural and experimental infections with Giardia isolated from cats. Can J Comp Med 48(3), 241-244.
Bouzid M, Halai K, Jeffreys D. et al. The prevalence of Giardia infection in dogs and cats, a systematic review and meta-analysis of prevalence studies from stool samples. Vet Parasitol 2015; 207: 181-202
Caylor KB, Cassimatis MK. Metronidazole neurotoxicosis in two cats. J Am Anim Hosp Assoc 2001; 37: 258-262
Einarsson E, Ma’ayeh S, Svard SG. An up-date on Giardia and giardiasis. Curr Opin Microbiol 2016; 34: 47-52
ESCCAP Deutschland (2022) Giardien bei der Katze. Verfügbar unter: https://www.esccap.de/parasiten/einzeller/giardien-bei-der-katze/
(abgerufen am: 10. Oktober 2025).
ESCCAP Deutschland e.V. (2017): Hygienemaßnahmen bei Giardien (ESCCAP Tierhalter-Information). Verfügbar unter: https://www.esccap.de/v2/wp-content/uploads/2020/06/ESCCAP_Giardien_Factsheet_Hygienemassnahmen_2017.pdf
(abgerufen am: 10. Oktober 2025).
ESCCAP Deutschland (o. J.): Einzeller (intestinale Protozoen). Verfügbar unter: https://www.esccap.de/parasiten/einzeller/
(abgerufen am: 10. Oktober 2025).
Feng Y, Xiao L. Zoonotic potential and molecular epidemiology of Giardia species and giardiasis. Clin Microbiol Rev 2011; 24: 110-140
Kanski, S., Weber, K. & Busch, K. (2023): Ein Update zur felinen und caninen Giardiose. Tierärztliche Praxis. Ausgabe K: Kleintiere / Heimtiere, 51(6), S. 411–421. DOI: 10.1055/a-2191-1723
Kuzi S, Zgairy S, Byrne BB Suchodolski J, Turjeman S, Park SY, Aroch I, Hong M, Koren O, Lavy E (2023): Giardiasis and diarrhea in dogs: Does the microbiome matter? J Vet Intern Med. doi.org/10.1111/jvim.16894.
Olson EJ, Morales SC, McVey AS. et al. Putative metronidazole neurotoxicosis in a cat. Vet Pathol 2005; 42: 665-669
Pallant L, Barutzki D, Schaper R. et al. The epidemiology of infections with Giardia species and genotypes in well cared for dogs and cats in Germany. Parasit Vectors 2015; 8: 2
Pantchev, N. (2018) Giardien bei Hund und Katze. Verfügbar unter: https://www.idexx.de/files/pantchev-2018-giardien-hund-katze-de-de.pdf
(abgerufen am: 10. Oktober 2025).
Pilla R, Gaschen FP, Barr JW. et al. Effects of metronidazole on the fecal microbiome and metabolome in healthy dogs. J Vet Intern Med 2020; 34: 1853-1866
Ryan UM, Feng Y, Fayer R. et al. Taxonomy and molecular epidemiology of Cryptosporidium and Giardia – a 50 year perspective (1971-2021). Int J Parasitol 2021; 51: 1099-1119
Sprong H, Cacció SM, van der Giessen JW. et al. Identification of zoonotic genotypes of Giardia duodenalis . PLoS Negl Trop Dis 2009; 3: e558
Stein JE, Radecki SV, Lappin MR (2003): Efficacy of Giardia vaccination in the treatment of giardiasis in cats. J Am Vet Med Assoc 222(11), 1548-1551.

