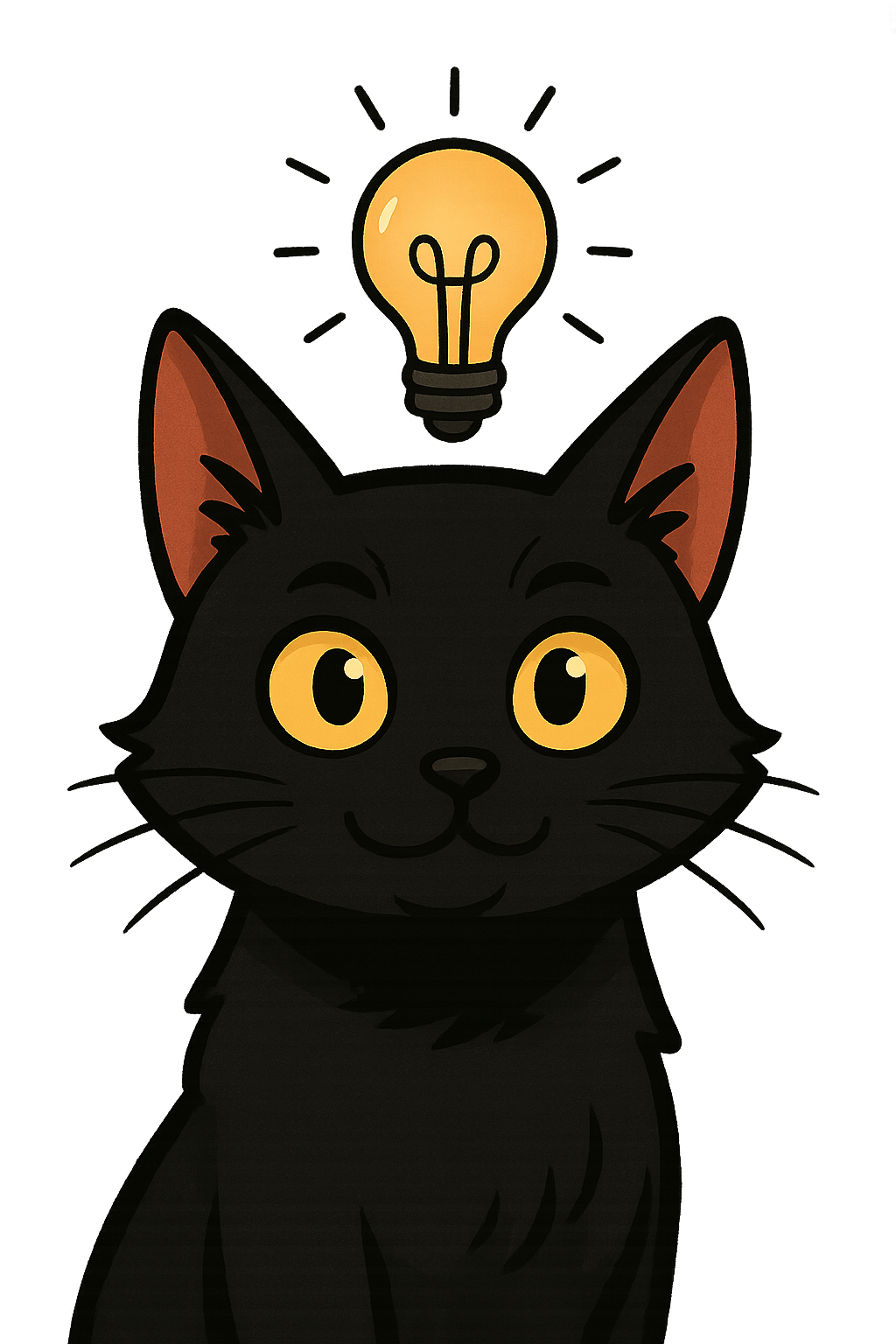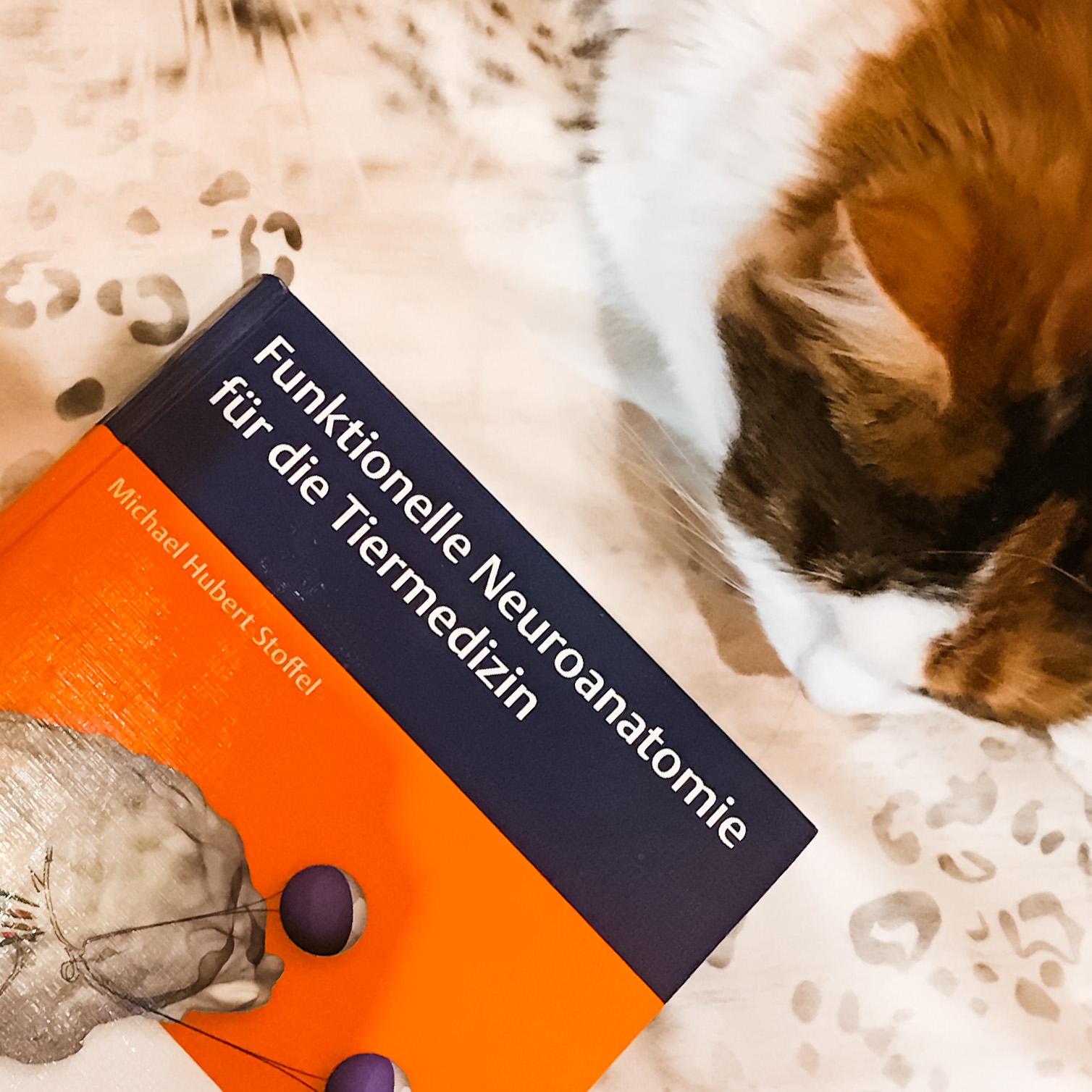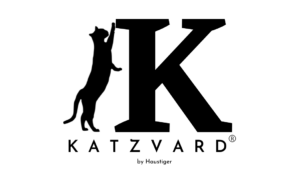Studie: Gen beeinflusst Verhalten
Wissenschaft
Studie: Gen beeinflusst Katzenverhalten
Katzen gehören zu den beliebtesten Heimtieren weltweit und leben eng mit uns Menschen zusammen. Anders als ihre wilden Vorfahren – wie die afrikanische Wildkatze (Felis lybica) – zeigen Hauskatzen ein erstaunlich breites Repertoire an sozialen Verhaltensweisen. Sie kommunizieren mit Artgenossen und Menschen über Gerüche, Körpersprache, Berührungen und verschiedene Lautäußerungen. Besonders auffällig: das Schnurren.
Schnurren, im Englischen auch „Purring“ genannt, ist eine einzigartige Form der Lautkommunikation bei Katzen. Es wirkt beruhigend, signalisiert häufig Zufriedenheit und dient zugleich als Mittel zur Kontaktaufnahme – etwa zur Futterforderung. Zugleich schnurren Katzen auch in Stresssituationen oder bei Schmerzen und Krankheit. Forschende vermuten, dass es dann der Selbstberuhigung dient oder sogar heilende Effekte haben könnte. Die genaue Funktion des Schnurrens ist allerdings bis heute nicht abschließend geklärt. Jedoch tritt es in vielfältigen sozialen Kontexten auf: als Ausdruck von Wohlbefinden, zur Konfliktvermeidung oder in Form des sogenannten „Solicitation Purr“ – einer Variante mit hoher Frequenz, die besonders fordernd klingt und oft gezielt gegenüber Menschen eingesetzt wird.
Neben Umweltfaktoren und Lernerfahrungen könnten auch genetische Unterschiede eine Rolle spielen. In der Verhaltensforschung gilt das Zusammenspiel von „Anlage und Umwelt“ als entscheidend. Während bei Hunden der Einfluss der Genetik auf Verhalten gut dokumentiert ist, steckt die entsprechende Forschung bei Katzen noch in den Anfängen. Die aktuelle Studie aus Japan leistet hier wichtige Pionierarbeit – und stellt das Androgenrezeptor-Gen ins Zentrum der Analyse.
Ziel der Studie
Methodik
An der Studie nahmen 280 kastrierte Hauskatzen teil (145 männliche, 135 weibliche Tiere). Die Halterinnen und Halter füllten einen umfassenden Fragebogen aus, den sogenannten Fe-BARQ (ein wissenschaftlich entwickelter Fragebogen zur Einschätzung des Katzenverhaltens, kurz für Feline Behavioral Assessment and Research Questionnaire). Mit diesem wissenschaftlich erprobten Instrument wurden 23 verschiedene Verhaltensmerkmale erfasst.
Parallel dazu analysierten die Forschenden eine genetische Sequenz im ersten Exon des AR-Gens der Tiere. In diesem Abschnitt variiert die Anzahl sogenannter CAG-Wiederholungen, also kleiner genetischer Bausteine, die je nach Häufigkeit unterschiedliche Genvarianten (sogenannte Allele) erzeugen. Je nach Länge dieser Wiederholungen wurden die Katzen in zwei Gruppen eingeteilt:
- Kurz-Typ: bis zu 18 Wiederholungen
- Lang-Typ: 19 oder mehr Wiederholungen
Die Ergebnisse der Verhaltensauswertung wurden dann mit den genetischen Daten in Beziehung gesetzt.
Ergebnisse der Studie
Die Studie zeigte mehrere interessante Zusammenhänge zwischen Genotyp und Verhalten:
- Schnurren: Katzen mit dem Kurz-Typ schnurrten laut Angaben ihrer Halterinnen und Halter deutlich häufiger.
- Lautäußerungen bei männlichen Katzen: Kater mit der Kurz-Variante des Gens zeigten signifikant mehr gezielte Lautäußerungen (z. B. Miauen zur Kommunikation).
- Aggression bei weiblichen Katzen: Weibliche Kurz-Typ-Katzen zeigten mehr Aggression gegenüber fremden Personen.
- Domestikationsspur: Lange Allele (20–22 Wiederholungen) traten ausschließlich bei Hauskatzen auf, nicht bei Wildkatzen. Dies deutet darauf hin, dass diese Genvariante möglicherweise im Zuge der Haustierwerdung positiv selektiert wurde.
Fazit
Die Studie liefert erste klare Hinweise darauf, dass genetische Faktoren – konkret die Länge eines CAG-Repeat-Abschnitts im AR-Gens – das Verhalten von Hauskatzen mitbestimmen können. Schnurren, Kommunikationsverhalten und soziale Reaktionen auf Menschen sind demnach nicht nur erlernt oder umweltbedingt, sondern könnten auch genetisch vorgeprägt sein.
Das macht die Ergebnisse besonders interessant für Katzenhalter:innen, Verhaltenstherapeut:innen, Tierärzt:innen und die Forschung. Langfristig könnte genetisches Screening eine neue Rolle in der Verhaltenseinschätzung und -beratung spielen. Bis dahin liefert die Studie aber vor allem eines: neue Denkanstöße über das Zusammenspiel von Erbanlagen und Verhalten.
Referenz: Yume Okamoto, Madoka Hattori, Miho Inoue-Murayama. Association between androgen receptor gene and behavioral traits in cats (Felis catus). PLOS One, 2025; 20 (5): e0324055 DOI: 10.1371/journal.pone.0324055

In a Nutshell / Zusammenfassung
- Was wurde untersucht?
Der Zusammenhang zwischen Varianten im Androgenrezeptor-Gen (AR-Gen) und dem Verhalten von Hauskatzen. - Wie wurde geforscht?
Kombination aus Verhaltensfragebogen (Fe-BARQ) und genetischer Analyse (CAG-Wiederholungen). - Was kam heraus?
Katzen mit der Kurz-Variante des Gens schnurrten mehr, männliche Tiere äußerten sich häufiger stimmlich, weibliche Tiere zeigten mehr Aggression gegen Fremde. - Warum ist das relevant?
Die Ergebnisse liefern neue Erkenntnisse über die genetische Basis von Katzenverhalten – mit Bedeutung für Haltung, Forschung und tiermedizinische Beratung.